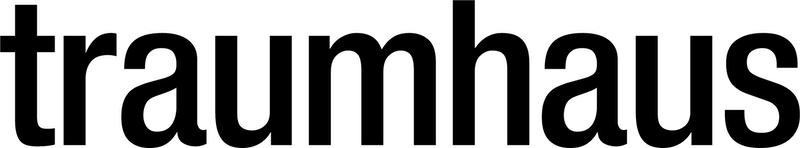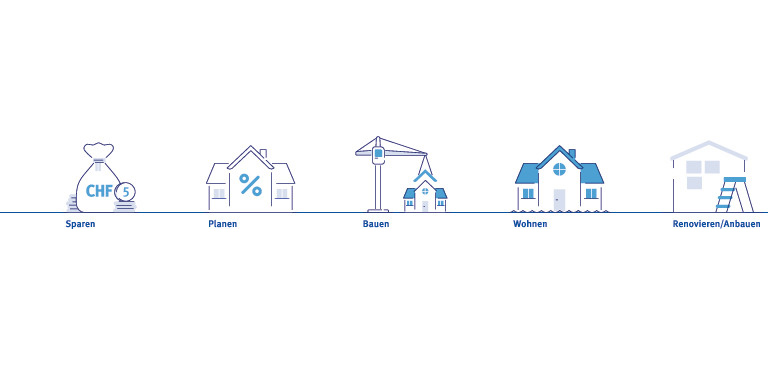Raus aus der Stadt, Rein ins nachhaltige Wohnen
Die Frage, wie wir wohl in Zukunft wohnen werden, hat Designer und Zukunftsforscher schon immer beschäftigt. Die Corona-Krise bestärkt Trends und beschleunigt Entwicklungen hin zu einem naturverbundenen Leben.

Ein Haus am See mit Blick auf die Berge, eine zauberhafte Penthouse-Stadtwohnung oder, wenn es kleiner sein soll, ein kuscheliger Altbau: Wäre das etwas für Sie? «Dream on», sagen die Amis oft zu derartigen Fantasien. Die Big Data zur Stadtentwicklung der Zukunft sind ähnlich sarkastisch und meinen, je höher die Dichte, desto besser das Wohnen. All das, was uns Menschen so gefällt, scheint zu wenig energieeffizient, zu kostspielig, zu gross, zu umweltschädigend und zu kompliziert zu sein. Einige Architekten würden uns alle am liebsten in Tiny Houses stecken oder in Kapseln, die nur zweckgebunden das Bedürfnis nach einer Schlafstätte sichern. Die letzten Jahrzehnte bewegten sich zwischen Alexa-getriebenen Volldigitalbunkern und avantgardistischen Unwohnbarentwürfen. Funktionalität erstickte meist Ästhetik. Und das, obwohl Urbanisten und Designer wie Stefan Sagmeister schon längst überzeugend darlegten, dass nur schöne Städte sichere, inspirierende, demokratische und humanistische Zentren inkarnieren können. In der Ausstellung «Schönheit» zeigte sein Büro Sagmeister & Walsh, wie wichtig «Beauty» für Lebens- und Politikqualität von Städten und deren Wohneinheiten wäre. Sein Ruf blieb jedoch bislang ungehört.
Doch dann passierte etwas, womit niemand gerechnet hatte: Corona
Über Nacht wurden Behausungen zu Homeoffice, Homeschooling und staatlich erzwungenem Heimurlaub transformiert. Gleichzeitig verstummte das vibrierende Stadtleben, und eine grosse Landflucht war angesagt. Corona machte von einem Tag auf den anderen alles, was die Mieten in Grossstädten so hochtreibt, zunichte. «Distancing» ist das Gegenteil dessen, was städtische Verdichtung, öffentlicher Verkehr, Bars, Kneipen, Restaurants und Theater brauchen. Corona machte etwas ganz anderes hip: den direkten Zugang zur Natur. Austoben durfte man sich mit bundesrätlichem Segen nur noch draussen: «Besuchen Sie die Naturschönheiten, machen Sie Sport, geniessen Sie das feine Essen – alles, was wir haben», meinte Finanzminister Ueli Maurer stolz.
Corona wirft seitdem jedes gültige Metropolis-Konzept über den Haufen. Die Zukunft des Wohnens ist nicht mehr zentral, sondern ländlich. Das bedeutet zweierlei: Städte werden mehr und mehr zu Dörfern umgebaut, und Dörfer werden endlich wieder belebt. In Berlin fordern grosse Klubs DJ-Sets unter freiem Himmel. Alte Autokinobetreiber erneuern ihre Lizenz, und sogar im behäbigen Bern soll es bald Pop-up-Bars geben. Wie bei Stadtfesten sollen langfristig Strassen gesperrt und den in Stadtwohnungen ohne Balkon eingesperrten Menschen soll Raum verschafft werden. In Zürich fordern die Grünliberalen sogar, dass die Bäder am See, der Letten und der Limmatabschnitt beim Rathaus zur Freibadzone deklariert werden.
Die Sehnsucht nach Natur und Authentizität
Land, Natur, freier Himmel sind die Zukunft. Das entgegen sämtlichen Prognosen, dass die Städte in den nächsten Jahrzehnten bis zur Schmerzgrenze wachsen werden. Denn Homeschooling, Homeoffice oder, weniger nett formuliert, Heimschulung und Heimarbeit sind in der Pandemie zum Alltag geworden. Hält der Trend zur massiven Reduktion der Mobilität und der Stadtferne an, verschiebt sich alles wichtige Leben mehr und mehr ins Grüne, quasi als Kompensation für die Zwangsaufenthalte in den eigenen vier Wänden und die digitalen Erwerbs-, Vereins-, und Kulturarbeiten. Acht Stunden Zoom-Konferenzen und zehn Stunden Bildschirmarbeit pro Tag schreien förmlich nach Luft.
ReFeudalisierung von Wohnen, Leben und Arbeiten
Eine überteuerte, enge Zweizimmerwohnung mitten in der Stadt, ohne Balkon, ergibt in dieser digitalen Zukunft einfach keinen Sinn. «Meine Frau, mein Sohn und ich, wir haben New York City Mitte März verlassen und ein kleines Haus in der Nähe des Meeres gemietet, in Montauk auf Long Island. Wir gehen viel am Strand spazieren», gibt der Schriftsteller Daniel Kehlmann der «Süddeutschen Zeitung» via digitale Kommunikation zu Protokoll. Hier erkennen wir, wie die digitalen Revolutionen eine Refeudalisierung von Wohnen, Leben und Arbeiten bringen. Die einen ziehen aufs Land und spazieren am Strand, die anderen bleiben als Leiharbeiter, als Paketauslieferer, als Kassiererin, als Pflegerin, als Tramfahrer in der Stadt. Ambitionierte Wohnkulturen werden aufgrund der hohen öffentlichen Schulden durch die Corona-Krise – Experten rechnen mit einer mindestens 20-jährigen Schuldenwirtschaft für den wochenlangen Lockdown im Jahre 2020 – viel nachhaltiger ausfallen als bis anhin. Die grüne Stadt wird in kleine Dörfer und Quartiere gegliedert sein. Strassen werden für Fussgänger, Rollstuhlfahrende und Cyclemobilität zwecks «Distancing» in Post- und Pandemiezeiten autofrei. Abertausende von uns klebten während der Lockdown-Wochen am Bildschirm. Alle Menschen waren deshalb froh, neben Homeoffice, Homeschooling und anderen digitalen Vorrichtungen möglichst schnell aus den eigenen vier Wänden herauszukommen. Voll digitalisierte Wohnungen? Fehlanzeige. Je mehr digitale Arbeit, umso stärker das Bedürfnis nach digitalen Freiräumen: Menschen backen Brot, pflanzen auf kleinstem Raum einen Gemüsegarten, nähen aus alten Kleidern Masken, räumen radikal ihre Keller auf, legen Vorräte an und Einmachgläser bereit, putzen liebevoll von Hand. Viele Bauherren und Architektinnen realisieren jetzt schon: Die umfassende Digitalisierung und Virtualisierung des Alltags weckt in den Menschen das Bedürfnis nach authentischer Existenz in den eigenen vier Wänden. Der Mensch ist nicht nur ein soziales, sondern auch ein freies Tier. Wenn man ihn einsperrt, verlangt er/sie/es nach Freiheit im Grünen.
Kennen Sie die gläserne Apple-Firmenzentrale in Cupertino? Grösser als das Pentagon, fast vollständig aus nahezu unsichtbarem Glas bestehend, stellt sie den grössten Architektenflop aller Zeiten dar. «Wer im Apple-Glashaus sitzt, lebt gefährlich» titelte die «Berner Zeitung» trefflich (5. 3. 2018). Ständig laufen Mitarbeiter und Besucher gegen die Fensterscheiben und ziehen sich Gehirnerschütterungen und andere Verletzungen zu. In London bündelte die Glasfassade eines Protzhochhauses das Licht wie unter einem gigantischen Brennglas.
Post-Corona: Eine neue Zeitrechnung
Post-Corona wird das alles verändern: Bauen und Wohnen waren in der Postmoderne durch Leere geprägt. Ebenso durch den Ruf nach Volldigitalisierung all unserer Lebensumstände. Doch die Anstrengungen von Homeoffice und Homeschooling verdrängen «Bits und Bytes» durch Behaglichkeit und Schönheit. Glücklich waren die Menschen zu Corona-Zeiten nur in hochwertig geschützten Wohnbereichen mit Naturzugang: Da konnten Arbeiten, Wohnen und Familienleben ineinanderfliessen. Das Wohnen in der Zukunft wird das Verhältnis von Stadt und Land also auf den Kopf stellen. Ebenso die Ausstattung der Wohnungen: Nicht die Häuser werden intelligenter, sondern die ganze Umgebung wird natürlicher. Menschen wollen im digitalen Zeitalter autark mit der Natur – das können auch autofreie, breite Strassen mit Kräuteralleen sein – verbunden sein. Häusermaterialien werden verstärkt aus bestehendem Abfall der Autozeit hergestellt werden: Dosen, Autoreifen, Glasflaschen sind perfekte Grundlagen für Häuser aus einer Mischung aus Lehm- und Gewächshäusern. Statt Single-Haushalten werden mehr und mehr Anlagen mit Möglichkeiten zum Rückzug in einzelne Zimmer und grosszügigen Begegnungsräumen konzipiert. Seit jeher zerbrachen sich die Menschen den Kopf, wie sie ihren Mitmenschen ein angemessenes Leben für wenig Geld ermöglichen könnten. Die Antworten begannen nach jeder grossen Krise mit der Verbesserung der Wohn- und Lebensumstände. Aus der Wohnzukunftsforschung wissen wir von der Sehnsucht der Menschen nach gemeinschaftlichen Werten und einer abwechslungsreichen Wohnumwelt. Wohnen und Arbeiten sollen Hand in Hand mit der Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen voranschreiten.
Wohnen in der Zukunft ist eines der urbanen Digitalität und der ländlichen Inspiration. Es wird weniger Pendler geben und hoffentlich weniger Armut, da die Ghettobildung auf dem Land nicht die Ausmasse annimmt wie in der Stadt. Es wird keine grauen Vororte mit nicht inspirativen Bebauungsteppichen mehr geben, sondern harmonisch gewachsene Erd- und Grünbehausungen. Orte, wo viele Menschen zusammen weniger Ressourcen als in den bisherigen Grossstädten verbrauchen. Nachhaltigkeit dominiert, Nestwärme und Komfort hochwertiger ökologischer Ausstattung sind angesagt. Wohnen in der Zukunft gestaltet kulturelle, wirtschaftliche und naturverbundene Potenziale, Oasen für Wissen und Lebensqualität innerhalb einer direkten Demokratie. Bauen bedeutete immer, gerade in der Schweiz, die Verbindung von Gemeinwesen, Arbeiten und Wohnen. Das hat Corona gezeigt: Über Nacht kann alles anders werden.
«Nicht die Häuser werden intelligenter, sondern die Umgebung wird natürlicher.»Regula Stämpfli
3 Fragen an Regula Stämpfli
INterview Donika Gjeloshi
Regula Stämpfli, Sie sagen, dass das Stadtleben unattraktiv geworden und in Zukunft das Dorfleben gefragt sei. Ist eine Entvölkerung der Stadt angesichts des Bevölkerungswachstums realistisch?
Entvölkerung klingt so martialisch. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Menschen in der Stadt den Lockdown viel schlechter ertragen haben als auf dem Land. Alle sozialen Probleme verschärften sich in der Stadt, während gerade Kinder aus schweren sozialen Verhältnissen auf dem Land wenigstens noch die Freiheit der Natur haben.
Kann die Digitalisierung zu Behaglichkeit beitragen?
Digitalisierung ist nie gemütlich. Digitales Arbeiten ermöglicht lediglich Distanzüberwindung und die Verbindung über den ganzen Globus hinweg. All der Alexa-Schnickschnack wird sich einpendeln zugunsten einer wirklichkeitsnahen und krisensicheren Bauweise.
Werden die von Corona angestossenen Veränderungen nachhaltig sein?
Im nächsten Jahr wird sicherlich noch versucht, alles wieder auf null, d. h. den Zustand vor Corona, zu stellen. Doch schon die Finanzkrise hat gezeigt: Vieles ist im Fluss und ändert sich. Wäre
Corona nicht gekommen, wären wir punkto autofreie Städte schon viel weiter, und die Fridays for Future hätten die politische Agenda punkto Nachhaltigkeit weitergebracht. Nun wird für ein, zwei Jahre totaler Rückschritt geprobt – bis zur nächsten Pandemie, Finanzkrise oder sonstigen Katastrophe. Die Menschen sind indessen durch den Lockdown wirklich bis ins Mark getroffen worden. Diese Erfahrung bleibt und zeigt Veränderungen.
Zur Gastautorin

Dr. phil. Regula Stämpfli ist Philosophiedozentin (Universität St. Gallen) mit Schwerpunkt Hannah Arendt, Political Design, Digital Transformation und Demokratietheorie. Sie war von 2005 bis 2014 Vorstandsmitglied und Intendantin des Internationalen Forums für Gestaltung in Ulm, seitdem leitet sie zusammen mit ihren Kollegen digitale, urbane und mobilitätsorientierte Projekte unter dem Titel «Designing Politics – the Politics of Design». Die Bernerin, die 2016 unter den 100 einflussreichsten Businessfrauen der Schweiz aufgeführt wurde, ist Vorstandsmitglied von Swissfuture und lebt seit einigen Jahren mit ihrer Familie in München.