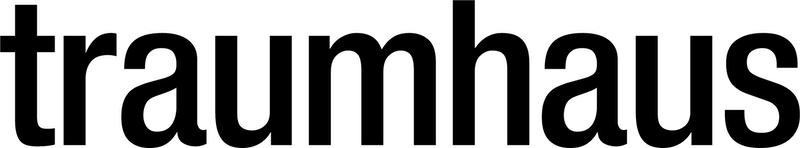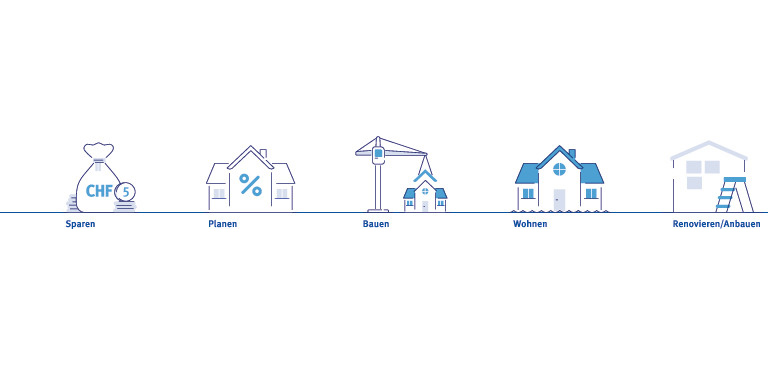Neue Steuerabzüge für energetische Massnahmen
Für Hausbesitzer gelten ab 1. Januar 2020 neue Regeln bei den Abzügen der direkten Bundessteuer. Der Gründer von Moneypark erklärt im Gastbeitrag, wie energiesparende und umweltschonende Investitionen schon vor Baubeginn auf bis zu drei aufeinanderfolgende Steuerperioden verteilt werden können.

Mit sanierten Immobilien Klimaziele erreichen
Bau und Betrieb von Gebäuden machen fast die Hälfte des schweizerischen Energieverbrauchs aus. Ausserdem entstehen rund 50 Prozent der CO₂-Emissionen im Gebäudebereich. Die Erneuerungsrate schlecht gedämmter Häuser liegt trotzdem bei nur 1 Prozent pro Jahr. Im Rahmen der Energiestrategie 2050 wurden verschiedene Massnahmen ausgearbeitet, um Eigenheimbesitzern Sanierungsanreize zu schaffen. Dafür revidierte der Bundesrat die Liegenschaftskostenverordnung. Sie tritt per 1. Januar 2020 in Kraft und beinhaltet zwei Neuerungen:
1. Rückbaukosten von nicht sanierten Gebäuden sind steuerlich abzugsfähig, sofern ein energieschonenderer Neubau entsteht.
2. Abzüge von energiesparenden und umweltschützenden Investitionen können auf maximal drei Steuerjahre verteilt werden.
Die Verordnung gilt für die Berechnung der Bundessteuer. Die Kantone sind indes frei, die Steuererleichterungen in ihr Recht zu übernehmen.
Rückbaukosten neu steuerlich abzugsfähig
Gegenwärtig können Hausbesitzer alle Aufwendungen, die den Zustand der Liegenschaft erhalten, vom steuerbaren Einkommen in Abzug bringen. Darunter fallen Ersatzanschaffungen, Reparaturen, Renovationen und Unterhalt (zum Beispiel des Gartens), aber auch Verwaltungskosten, Versicherungsprämien und energetische Sanierungen. Zu den energetischen Sanierungen zählen zum Beispiel die Wärmedämmung sowie erneuerbare Energien nutzende Installationen wie Solarzellen oder eine Wärmepumpe. Sogar der Ersatz von Haushaltsgeräten gilt unter Umständen als energetische Sanierung und ist somit steuerlich abzugsfähig. Steuerlich nicht berücksichtigt werden hingegen wertvermehrende Investitionen.
Mit der nun neu eingeführten Abzugsfähigkeit der Rückbaukosten möchte der Gesetzgeber Anreize schaffen, damit alte, energiefressende Gebäude abgerissen und durch energetisch bessere und umweltfreundlichere Gebäude ersetzt werden. Steuerlich geltend gemacht werden können die Kosten für den Rückbau daher auch nur, wenn innerhalb einer angemessenen Frist von derselben Person ein neues Gebäude auf demselben Grundstück errichtet wird. Der Ersatzneubau muss ausserdem eine gleichartige Nutzung wie das bisherige Gebäude aufweisen. Zu den neu abzugsfähigen Rückbaukosten zählt aber nicht nur der komplette Abriss des Gebäudes, sondern beispielsweise auch der Ausbau einer Ölheizung zugunsten einer Wärmepumpe. Konnten bisher nur die Installationskosten der Wärmepumpe steuerlich berücksichtigt werden, können neu auch die Ausbaukosten der Ölheizung steuerlich abgezogen werden.
Verrechnung über drei Steuerperioden
Der zweite steuerliche Anreiz, eine Sanierung vorzunehmen, besteht in der Übertragungsmöglichkeit der Investitionskosten auf maximal zwei weitere, total also drei Steuerperioden. Bisher konnten die Kosten nur in dem Jahr, in dem die Arbeiten ausgeführt wurden, steuerlich berücksichtigt werden. Im Falle eines dadurch resultierenden negativen Reineinkommens war es dem Eigentümer nicht möglich, von den gesamten Abzügen zu profitieren, ausser die Ausführung der Arbeiten wurde über die nächsten Jahre verteilt oder die Handwerker splitteten die Rechnungen auf verschiedene Jahre.
Mit Einführung des neuen Gesetzes werden die Investitionskosten zum Energiesparen, für den Umweltschutz oder für den Rückbau, welche in einem Steuerjahr nicht vollständig berücksichtigt werden können, auf die nächste Steuerperiode überwälzt. Je nach Summe der Investitionen ist es daher möglich, in bis zu drei aufeinanderfolgenden Jahren von null Reineinkommen zu profitieren. Aber Achtung!: Die Kosten, welche nicht energetische Arbeiten abdecken, dürfen auch weiterhin nur im Rechnungsjahr steuerlich abgezogen werden.
Finanzierung der Sanierung muss sichergestellt sein
Die Aussicht auf Steuererleichterungen in den nächsten Jahren wird hoffentlich vermehrt Eigenheimbesitzer dazu ermutigen, energetische Sanierungen vorzunehmen. Aber es können nicht nur Steuern gespart werden: Grössere Sanierungen, die einmalig vorgenommen werden, sind tendenziell günstiger als einzelne kleinere Sanierungen über Jahre hinweg verteilt. Dabei muss allerdings auch die entsprechende Investitionssumme zur Finanzierung bereitstehen. Wer die Liquidität nicht bereits angespart hat, sollte über eine Hypothekarerhöhung nachdenken. Die Chance ist gross, dass diese gewährt wird, denn normalerweise erhöht sich der Wert der Liegenschaft nach erfolgter Sanierung. Und das tiefe Zinsniveau ermöglicht derzeit die Hypothekaraufnahme zu historisch tiefen Konditionen.
Eigenmietwert als Unsicherheitsfaktor
Auch wenn die künftig gelockerten Steuerbedingungen erfreuen: Die Unsicherheit bezüglich einer möglichen Abschaffung des Eigenmietwerts trübt auch die Wirkung dieser Steuermassnahmen. Zurzeit läuft der politische Vorstoss, den Eigenmietwert abzuschaffen. Sollte der Vorstoss umgesetzt werden, würden wohl auch die steuerlichen Abzugsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Die Vorlage sieht momentan zwar noch vor, die Abzüge für Energiesparen, Umweltschutz, Denkmalpflege und Rückbau auf Kantonsebene weiterhin zuzulassen, auf Bundesebene – wo die neue Liegenschaftskostenverordnung auch tatsächlich greift – jedoch nicht.
Das letzte Wort ist aber noch längst nicht gesprochen: Die Vernehmlassung zu den Vorschlägen der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats dauerte bis Mitte Juli 2019 und erntete auch Kritik. So meldeten beispielsweise die kantonalen Finanzdirektionen, dass sie keinen Reformbedarf bei der geltenden Wohneigentumsbesteuerung sähen. Die mutmasslichen finanziellen Einbussen wögen zu schwer: Die Komplexität der Abzüge erhöhe sich, und die Reform widerspreche der angestrebten Steuerharmonisierung.
Ob der Eigenmietwert abgeschafft wird und wenn ja, unter welchen steuerlichen Bedingungen, ist also noch völlig offen. In der Wintersession im Dezember dieses Jahres wird der Ständerat das Geschäft diskutieren und allfällige Anpassungen an der Vorlage vornehmen. Anschliessend wird die Vorlage im Nationalrat behandelt. Eine Abstimmung und damit der Entscheid der Räte ist also nicht vor Sommer 2020 zu erwarten.
Ein Rechnungsbeispiel
| Erwerbseinkommen | + | 120 000 CHF |
| Eigenmietwert | + | 15 000 CHF |
| Energiesparende Investitionen | – | 150 000 CHF |
| Liegenschaftsunterhalt | – | 25 000 CHF |
| Sonstige Abzüge (Berufsauslagen, Schuldzinsen, Versicherungen usw.) | – | 30 000 CHF |
| Reineinkommen | – | 70 000 CHF |
In diesem Rechnungsbeispiel versteuert der Eigenheimbesitzer ein Reineinkommen von null. Bisher waren die 70 000 Franken «verloren», ab 2020 können diese auf die nächsten zwei Steuerjahre übertragen werden.