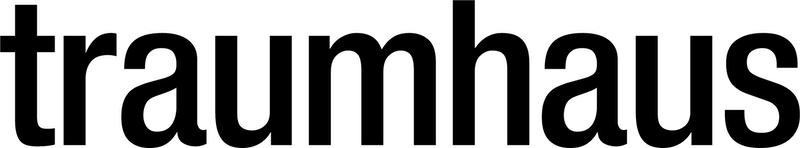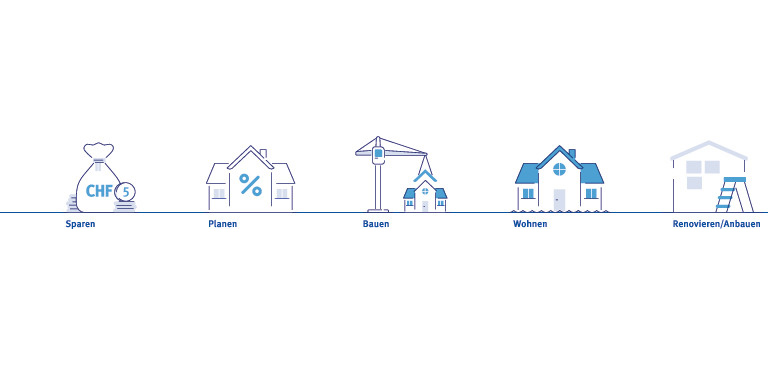Cheminées und Öfen: die feinen Unterschiede
Gerade wenn die Tage kürzer, karger und kälter werden, wirkt das knisternde Holzfeuer wie Balsam für die Seele und schafft ein wohlig warmes Ambiente im Haus. Doch wie wählt man das richtige Cheminée fürs Eigenheim? Lukas Bühler, Geschäftsführer der Tiba AG, gibt Antwort auf diese und andere brennende Fragen.

Welche Arten von Feuerstellen gibt es?
Sehr viele. Leider herrscht bereits bei den Begrifflichkeiten grosse Verwirrung, da die Grenzen fliessend sind. Die wichtigsten Typen sind das Cheminée, der Cheminéeofen, Kachelofen, Speicherofen, Pelletofen und der Holzherd.
Was zeichnet diese aus?
Das Cheminée ist ein Einbaugerät mit grosser Glasscheibe. Die grosse Feuerstelle heizt den Raum schnell auf; sobald das Feuer erlischt, kühlt der Raum auch schnell wieder ab. Der Cheminéeofen, auch Schwedenofen oder einfach Ofen genannt, besteht meistens aus einem freistehenden Stahlkorpus mit relativ gross verglasten Ofentüren und meist sichtbarem Kaminrohr. Speicheröfen sind Cheminéeöfen mit kleinerem Fenster, damit mehr Wärme gespeichert wird. Kachelöfen sind innen mit Stein gemauert und können dadurch die Wärme lange speichern. Sie haben meistens ein kleines Fenster, damit nicht zu viel Wärme in den Raum hinausstrahlt. Pelletöfen funktionieren vollautomatisch per Knopfdruck, geheizt wird mit Holzpellets. Der Holzherd schliesslich stellt in der Küche auch einen grossen Marktanteil dar, er wird sowohl zum Heizen als auch zum Backen genutzt.
Wie unterscheiden sie sich bezüglich der Funktion?
Allgemein kann man die verschiedenen Typen in zwei Kategorien einordnen: Geräte für das Ambiente-Feuer und Geräte als Zusatzheizung. Wer die Feuerstelle primär für eine gemütliches Ambiente nutzen will, wählt ein Cheminée oder einen Cheminéeofen. Bei diesen heizt man mit etwa zwei Kilogramm Holz und legt nach Bedarf immer wieder Holz nach. Das Feuererlebnis ist intensiver mit grosser Flamme, aber auch mehr Wärmeentwicklung. Wer die Feuerstelle zum Heizen nutzen will, der wählt einen Speicherofen, Kachelofen, oder Pelletofen. Beim Speicherofen und beim Kachelofen wird relativ viel Holz auf einmal gefeuert, fünf bis zwölf Kilogramm. In zwei Stunden brennt das Holz ab. Die erzeugte Hitze wird während der nächsten zehn bis zwölf Stunden in den Raum abgegeben. Ein Pelletofen fasst 25 bis 50 kg Holzpellets. Da er vollautomatisch funktioniert, kann der Nutzer genau bestimmen, wann, wie lange und wie viel geheizt wird.
Ist die Holzfeuerung denn überhaupt umweltfreundlich?
Ja, definitiv. Erstens ist Holz ein CO₂-neutraler Brennstoff. Das heisst, dass das Holz beim Verbrennen nur so viel CO₂ freisetzt, wie es beim Wachstum gebunden hat; damit ist der CO₂-Kreislauf geschlossen. Zweitens ist Holz ein regionaler Brennstoff: Meist kommt es aus der Gemeinde oder aus der näheren Umgebung. Der Anteil an grauer Energie, das ist die Energie, die für den Transport und die Aufbereitung aufgewendet wird, ist damit sehr gering. Drittens sind moderne Feuerungen sehr effizient und sauber, was die Verbrennung selbst betrifft – im Gegensatz zu zum Beispiel alten offenen Cheminées.
Wie funktioniert die Wärmeverteilung?
All die erwähnten Produkte gibt es als luft- oder wassergeführte Variante. Bei wassergeführten Geräten werden dank einem Wärmetauscher 40 bis 70 Prozent der Energie direkt in das Zentralheizsystem eingespeist und die Wärme in alle Räume weitergeleitet. Insbesondere bei Luft-Wasser-Wärmepumen sind wassergeführte Geräte sinnvoll, da sie bei Minustemperaturen im Winter das Heizsystem gut unterstützen können. Wassergeführte Geräte sind daher in gut isolierten Neubauten sinnvoll. Bei Öfen ohne Wärmetauscher wird der Raum direkt erwärmt, dies erfolgt entweder über Warmluftkonvektion bei normalen Öfen oder als Strahlungswärme bei Speicheröfen.
Kann man auch in einem Minergie-Haus ein Cheminée oder einen Ofen einbauen?
Ja, jedoch müssen dann einige Punkte beachtet werden: Bei Minergie-Häusern muss man eine Luftzufuhrleitung im Voraus planen, damit die Luft, die das Feuer braucht, direkt von aussen über eine isolierte Leitung, meistens am Boden oder an der Wand, ins Gerät zugeführt wird. Da die Komfortlüftung einen leichten Unterdruck im Haus entstehen lässt, ist es wichtig, dass kein Rauch aus dem Ofen austreten kann. Deshalb muss das Cheminée oder der Ofen dicht gebaut sein. Man spricht von raumluftunabhängigen Geräten. Ausserdem würde ich ein Gerät empfehlen, das die Wärme länger speichert und langsam im Raum verteilt. Mit einem Cheminée mit grossem Fenster würde der gut isolierte Raum eines Minergie-Hauses sehr schnell überhitzen.
Gibt es grosse Unterschiede bezüglich Wartungsaufwand bei den verschiedenen Geräten?
Der Wartungsaufwand ist bei allen Geräten etwa gleich gross. Neben der Reinigung des Feuerraums und des Fensters muss einmal im Jahr ein Kaminfeger das System reinigen. Bei wassergeführten Geräten muss zusätzlich einmal im Monat der Wärmetauscher vom Nutzer selbst gereinigt werden.
Wie ist der Preisunterschied?
Den Cheminéeofen, Pelletofen, Holzherd und Speicherofen gibt es ab 4000 Franken, den Kachelofen und das Cheminée ab 10 000 Franken inklusive Installation. In das Budget einplanen sollte man auch die Baukosten für den Kamin, an den man das Gerät anschliessen muss. Diese belaufen sich auf zwischen 3500 und 7000 Franken.
Braucht es eine Baubewilligung?
Für den Kamin, der meistens an der Fassade sichtbar ist, muss bei der Gemeinde eine entsprechende Baubewilligung eingeholt werden. Für das Gerät selbst braucht es dann keine Bewilligung mehr, jedoch muss jede Feuerstelle beim Feuerschauer der Gemeinde gemeldet werden. Die Anmeldung kostet nichts und wird gewöhnlich vom Ofenbauer direkt erledigt.
Ist der Aufwand kleiner, wenn man gleich mehrere Geräte einbaut?
Der Aufwand liegt mehr bei der Errichtung des Kamins denn bei der Installation der Geräte. In einem Einfamilienhaus kann man ohne grossen Aufwand bis zu vier Geräte an einem Kamin anschliessen.
Kann man den Ofen oder das Cheminée auch nach dem Hausbau einbauen?
Das ist möglich. Der Standort des Kamins sollte dann an der Aussenfassade definiert sein. Auserdem muss man überprüfen, ob die Zuluft gewährleistet ist und ob der Boden das zusätzliche Gewicht tragen kann. Schliesslich muss man auch herausfinden, ob eventuelle Bodenbeheizungen ein Hindernis darstellen. Wenn diese Punkte jedoch bereits bei der Planung berücksichtigt wurden, sollte es kein Problem darstellen, das Cheminée oder den Ofen nachträglich einzubauen.
Wo ist der ideale Ort für das Cheminée oder den Ofen?
Wir empfehlen, dass das Gerät im Zentrum des Raumes oder an einer Innenwand positioniert wird, damit die Wärme möglichst lange im Raum bleibt. An einer Aussenwand würde man einen Teil der Energie verlieren.
Was muss sonst noch beachtet werden?
Bei einem Parkettboden braucht es unter dem Cheminée eine Platte als Funkenschutz. Bei einem Plattenboden ist das natürlich nicht mehr nötig. Man sollte sich auch darüber Gedanken machen, wo man das Holz lagern möchte, ob man einen Unterstand einplanen muss und wo man das Holz bezieht.
Was sind die Trends im Bereich Cheminée bzw. Ofen?
Mit weissen Steinen verkleidete Cheminées liegen im Trend, bei den Stahlöfen sind kubische Formen mit klaren Linien gefragt. Auf der technischen Ebene geht der Trend in Richtung Speichermasse. Man will die Energie effizienter nutzen. So kann man auch Cheminées und Cheminéeöfen mit einer Speichermasse ausstatten, damit sie die Wärme länger speichern.
Bevor sich nun die Bauherrschaft an einen Ofenbauer wendet: Worüber sollte sie sich zuvor im Klaren sein?
Die Bauherrschaft sollte sich zunächst überlegen, wie sie das Cheminée oder den Ofen nutzen will. Möchte man die Feuerstelle einmal im Monat, einmal in der Woche oder täglich nutzen? Möchte man sie des Ambientes wegen nutzen oder will man damit das Heizsystem ergänzen? Das Budget spielt auch eine wichtige Rolle für die Beratung. Schliesslich soll der Ofen oder das Cheminée auch optisch zur Architektur des Hauses passen.
Adressen von Ofenbauern findet man auf der Verbandshomepage: www.feusuisse.ch