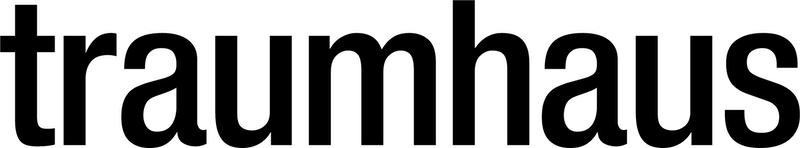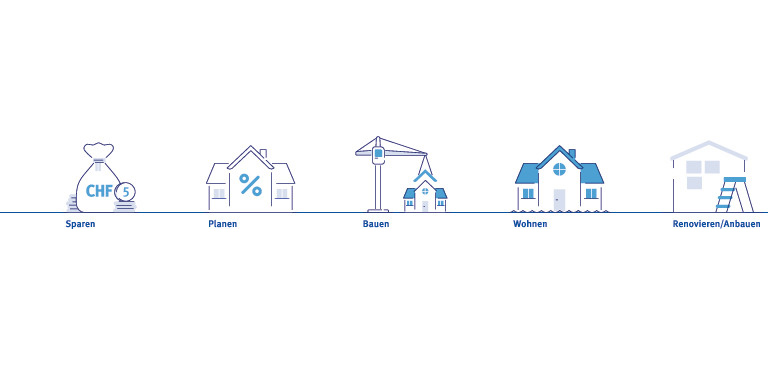Mit Unterhaltskosten Steuern senken
Wohneigentum bietet aus steuerlicher Sicht interessante Abzugsmöglichkeiten. Vor allem Unterhaltsarbeiten und energetische Verbesserungen können die Steuerbelastung senken.

Werterhaltend oder wertvermehrend?
Steuerlich gesehen gibt es zwei Kategorien von Unterhaltsarbeiten: werterhaltende und wertvermehrende. Die Ausgaben für werterhaltende Arbeiten können als Abzug in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Investitionen hingegen, die den Wert der Liegenschaft vermehren, kann man nicht abziehen. Bei vielen Sanierungsarbeiten vermischen sich diese beiden Kategorien. Schauen wir uns die drei Fälle konkret an.
Werterhaltende Aufwände
Alle Kosten für Arbeiten, die dazu dienen, den Wert der Liegenschaft zu erhalten, kann man vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen abziehen. Das umfasst zum Beispiel die Reinigung oder den neuen Anstrich der Fassade, den Ersatz von Fensterläden durch ein gleichwertiges Modell oder das Auswechseln der Boden- oder Wandbeläge mit einem gleichwertigen Produkt. Bei einem neueren Haus halten sich solche Ausgaben naturgemäss in Grenzen. Dafür lassen sich gewisse Betriebskosten von den Steuern abziehen. Das umfasst Aufwendungen, die mit dem Besitz einer Liegenschaft wirtschaftlich oder rechtlich verknüpft sind. Typische Posten sind zum Beispiel die jährlichen Prämien für Schaden- oder Gebäudehaftpflichtversicherungen sowie Beiträge für Strassenunterhalt, -beleuchtung und -reinigung. Liegen diese Kosten tief, können Sie sich für den Pauschalabzug entscheiden. Und übrigens: Stockwerkeigentümer können ihre jährlichen Einlagen in den Erneuerungsfonds in den meisten Fällen ebenfalls als Unterhalt geltend machen und komplett vom steuerbaren Einkommen abziehen.
Wertsteigernde Investitionen
Anders sieht es aus, wenn Sie in Ausbauprojekte investieren. Ein typischer Fall ist der Umbau eines bisher ungenutzten Dachgeschosses. Wenn Sie dort neuen Wohnraum schaffen, können Sie diese Kosten in der Steuererklärung nicht abziehen. Das Gleiche gilt, wenn Sie ein zusätzliches Badezimmer oder einen Lift einbauen. Auch die Erweiterung der Liegenschaft um einen Wintergarten oder ein Schwimmbad kann schwerlich als werterhaltende Unterhaltsarbeit deklariert werden. Es handelt sich hier eindeutig um Ausgaben, die den Wert Ihrer Liegenschaft vermehren und folglich in der Steuererklärung nicht abzugsfähig sind. Eine gute Nachricht gibt es trotzdem: Man kann solche Investitionen bei einem späteren Verkauf der Immobilie in die Waagschale werfen und damit die anfallende Grundstückgewinnsteuer reduzieren. Das bedeutet aber auch, dass Sie dafür unbedingt die Belege von Rechnungen wie auch Zahlungen über Ihre Investitionen langfristig aufbewahren müssen.
Teilweise abzugsfähig
Viele Sanierungsmassnahmen stellen eine Kombination von werterhaltenden und wertvermehrenden Arbeiten dar. Wer zum Beispiel seine Küche erneuert, nutzt diesen Eingriff in der Regel für qualitative Verbesserungen: einen grösseren Kühlschrank, eine moderne Kochinsel oder einen multifunktionalen Backofen. Ähnlich sieht es bei einer Badezimmersanierung aus, wo neue Installationen wie ein Doppellavabo, eine Regendusche oder ein Closomat zusätzlichen Komfort bringen. Auch wer sein Garagentor oder die alten Sonnenstoren ersetzt, wählt oft ein hochwertigeres, automatisches Modell. Solche Qualitätsverbesserungen führen in der Regel dazu, dass ein Teil der Kosten als wertvermehrend und damit als nicht abzugsfähig taxiert wird. Die meisten kantonalen Steuerämter stellen für solche Abgrenzungsfragen Onlineinformationen zur Verfügung, aus denen detailliert hervorgeht, welcher Anteil der Ausgaben als werterhaltend beziehungsweise wertvermehrend gilt. Es ist empfehlenswert, diese Informationen frühzeitig durchzulesen und bei der (steuerlichen) Planung von Sanierungsprojekten zu berücksichtigen.
Nicole von Reding-Voigt, Vorstandsmitglied Treuhand Suisse
Steuerlich clever planen
Angenommen, Ihr Haus oder Ihre Wohnung ist in die Jahre gekommen und Sie planen eine umfassende Sanierung. Wenn Sie steuerliche Aspekte dabei strategisch in die Planung einfliessen lassen, kann das Ihre Steuerbelastung erheblich senken, wie das nachfolgende Beispiel zeigt. Gehen wir davon aus, dass der werterhaltende Anteil Ihrer Aufwände 200 000 Franken beträgt. Das wäre also der Betrag, den Sie vom steuerbaren Einkommen abziehen können. Nehmen wir ferner an, Ihr steuerbares Haushaltseinkommen beträgt 120 000 Franken. Und jetzt kommt die Krux. Denn wenn Sie die Sanierung in einem Schritt – also in einem Kalenderjahr – durchführen, bezahlen Sie in diesem Jahr zwar keinerlei Einkommenssteuern, weil Ihre Abzüge höher liegen. Allerdings verschenken Sie aus steuerplanerischer Sicht die Differenz von 80 000 Franken. Ihre Steuerersparnis ist deutlich höher, wenn Sie diese Sanierungsarbeiten über zwei, drei Jahre verteilen. Wenn Sie zum Beispiel über zwei Jahre je 100 000 Franken oder über drei Jahre jeweils rund 70 000 Franken abziehen. So brechen Sie die Steuerprogression und reduzieren Ihr steuerbares Einkommen über den entsprechenden Zeitraum spürbar. Wichtig ist bei diesem Modell, dass die Rechnungen der Handwerker in der Steuerperiode bezahlt werden, in der diese zum Abzug kommen sollen.
Privilegiert: energetische Massnahmen
Ausgaben für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen werden steuerlich privilegiert. Sie sind komplett abzugsfähig, auch wenn die Liegenschaft damit an Wert gewinnt. Wer also in den eigenen vier Wänden energetisch bessere Fenster einbaut, eine moderne Fassadendämmung oder Dachisolation realisiert oder in ein effizienteres System für Heizung und Warmwasseraufbereitung investiert, kann diese Kosten vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen abziehen. Seit dem 1. Januar 2020 haben sich die Einsparungsmöglichkeiten bei energetischen Sanierungen sogar nochmals verbessert. Neue Begünstigungen bringen es mit sich, dass man bei energetischen Sanierungen jetzt auch die Rückbau- und Entsorgungskosten von den Steuern abziehen kann. Zwei Beispiele: Wenn Sie als Eigenheimbesitzer Ihre Ölheizung durch eine Erdsondenheizung ersetzen, konnten Sie die Kosten für die Beschaffung und den Einbau schon bisher abziehen. Seit Anfang 2020 umfasst das auch den Aufwand für die Demontage, den Abtransport und die Entsorgung der alten Anlage. Ein zweites Beispiel im grösseren Massstab: Wenn Sie Ihr Wohnhaus ganz abbrechen und mit einem Neubau ersetzen, können Sie die damit verbundenen Rückbaukosten neu ebenfalls in der Steuererklärung geltend machen. Als abziehbare Rückbaukosten im Hinblick auf den Ersatzneubau gelten die Kosten der Demontage von Installationen, des Abbruchs des vorbestehenden Gebäudes sowie des Abtransports und der Entsorgung des Bauabfalls. Wichtig zu wissen ist überdies, dass solche Investitionen in Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen sowie Rückbaukosten im Hinblick auf den Ersatzneubau auf die beiden nachfolgenden Steuerperioden übertragen werden können, falls sie in dem Jahr, in dem sie angefallen sind, steuerlich nicht vollständig berücksichtigt werden können.
Kantonale Förderprogramme nutzen
Ein Teil der Kantone schafft mit speziellen Förderprogrammen weitere finanzielle Anreize für energetische Sanierungen. So hat zum Beispiel die Zürcher Regierung im Juli 2020 kommuniziert, dass sie den Ersatz der immer noch 120 000 Öl- und Gasheizungen im Kanton vorantreiben wolle. Klimaneutrale Heizsysteme, zum Beispiel Wärmepumpen, sollen mit zusätzlichen Fördermitteln unterstützt werden. Verpassen Sie es nicht, sich über entsprechende Möglichkeiten in Ihrem Wohnkanton zu informieren.