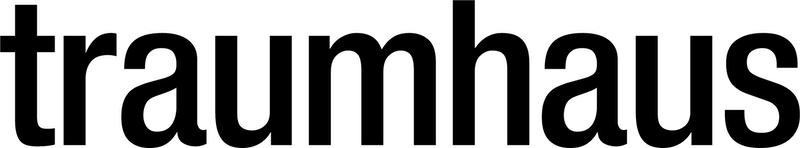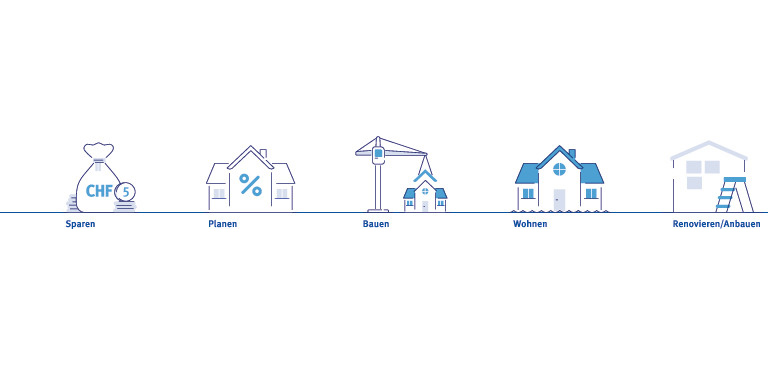Zu Lebzeiten das Haus vererben – so funktionierts
Viele ältere Wohneigentumsbesitzer überlegen sich, die Immobilie zu Lebzeiten an ihre Kinder abzutreten. Gleichzeitig möchten sie noch so lange wie möglich in den vertrauten vier Wänden wohnen bleiben. Wie lässt sich das unter einen Hut bringen?

Die drei Kinder sind längst ausgeflogen – das Ehepaar Bernasconi, Mitte 70, lebt immer noch im eigenen Haus. Es möchte die Immobilie weiterhin in der Familie behalten und sie den Kindern übereignen. Das soll noch zu Lebzeiten geschehen. Damit verbindet das Ehepaar auch die Hoffnung, dass der frühzeitige Eigentumsübertrag davor schützt, das Haus zur Finanzierung eines späteren Alters- oder Pflegeheimaufenthalts veräussern zu müssen.
Schenkung oder Erbvorbezug?
Wie übereignet das Ehepaar Bernasconi am besten das Haus, das einen Marktwert von 750 000 Franken und eine Resthypothek von 100 000 Franken aufweist? Als die beiden mit ihren drei Kindern Antonio, Bianca und Clara diskutieren, herrscht zuerst Verwirrung, ob der Eigentumsübertrag via Schenkung oder Erbvorbezug zu geschehen hat. Im Fall einer Liegenschaft spielt das keine Rolle – die Schenkung eines solchen Objekts wird wie ein Erbvorbezug behandelt und ist unter den Kindern ausgleichspflichtig. Keinen Unterschied gibt es auch punkto Steuern: Die meisten Kantone kennen für Kinder weder Schenkungs- noch Erbschaftssteuern.
Gemischte Schenkung: das Kleingedruckte zählt
Im Lauf der Diskussion realisieren die Eltern plötzlich: Mit dem entschädigungslosen Übertrag der Liegenschaft würden sie finanziell völlig abhängig von ihren Kindern, denn sie verfügen über keine nennenswerten weiteren Vermögenswerte. Daher zieht das Ehepaar eine gemischte Schenkung vor, also einen Verkauf unter dem Liegenschaftswert. Die Eltern schlagen einen Preis von 450 000 Franken vor – die Differenz von 200 000 Franken zum Nettowert von 650 000 Franken wäre demnach eine Schenkung an die Kinder (siehe Textbox).
Unter diesen finanziellen Umständen möchte sich die Tochter Clara nicht am Erwerb der Liegenschaft beteiligen. Wird keine anderslautende Vereinbarung getroffen, müssen die beiden anderen Geschwister Antonio und Bianca die 200 000 Franken später bei der Erbteilung gegenüber Clara ausgleichen. Dasselbe gilt für die bis dann auflaufenden Wertsteigerungen und Ertragsvorteile der Liegenschaft. Wie können Antonio und Bianca also den Kauf stemmen? Damit sie keine Bankhypothek aufnehmen müssen, lassen die Eltern den Kaufpreis als Darlehen stehen. Von dieser Lösung profitieren auch sie: Verglichen mit dem Sparkonto kann das Darlehen eine gut verzinste Anlage darstellen. Eine «Win-win-Situation» also. Die elegante Lösung einer gemischten Schenkung hat allerdings einen Haken: Würden Antonio und Bianca die unter dem Marktwert erworbene Liegenschaft verkaufen, würden sie sich einen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen. Daher können die Eltern im Kaufvertrag einerseits einen Gewinnanspruch bei einer vorzeitigen Veräusserung vorsehen, andererseits ein Vorkaufsrecht für sich und – nach ihrem Tod – für Clara.
Wohnrecht oder Nutzniessung?
Im weiteren Gespräch mit ihren Kindern äussern die Eltern den Wunsch, trotz Eigentumsübertrag noch möglichst lange im Haus wohnen zu können. Sie schlagen daher vor, dass ihnen ein Wohn- oder Nutzniessungsrecht eingeräumt wird. Antonio und Bianca kommt das gelegen, denn der Kaufpreis vermindert sich um den Wert dieses Rechts. Worin liegt der Unterschied zwischen Wohn- und Nutzungsrecht? Der Nutzniesser hat sehr viel weitreichendere Pflichten als der Wohnberechtigte. So kommt der Nutzniesser nicht nur für den Eigenmietwert und den normalen Unterhalt der Liegenschaft auf wie der Wohnberechtigte. Er trägt zusätzliche Lasten wie Hypothekarzinsen, Versicherungen, Abgaben und Vermögenssteuern. Andererseits räumt die Nutzniessung mehr Rechte ein – namentlich dürfen die Bernasconis Untermieter aufnehmen. Eine elegante Lösung, um die Rente aufzubessern.
Bis dass der Tod euch scheidet – oder das Heim
Keine Lösung finden lässt sich hingegen für das anfängliche Ziel des Ehepaars, sich durch den Vermögensübertrag an die Kinder vor den Kosten für einen späteren Alters- oder Pflegeheimaufenthalt zu schützen. Wer diese nicht selber bestreiten kann, erhält Ergänzungsleistungen (EL) – so der Grundsatz. Das verführt zur Idee, das eigene Vermögen an die Erben zu verschenken und dann die Heimkosten via EL bezahlen zu lassen.
Bei der Anspruchsberechnung wird aber freiwillig abgetretenes Vermögen berücksichtigt, abzüglich 10 000 Franken pro Jahr seit der Schenkung. Mit anderen Worten: Erst in 20 Jahren würde die EL keinen Rückgriff mehr auf jene 200 000 Franken nehmen, welche die Eltern in Form der gemischten Schenkung ihren Kindern zukommen liessen.
Gemischte Schenkungen: Vorsicht vor steuerlichen Stolperfallen
Die Schenkung bzw. der Erbvorbezug einer Liegenschaft ist von der Grundstückgewinnsteuer befreit. Bei der sogenannten gemischten Schenkung kennen aber viele Kantone die Einschränkung, dass der unentgeltliche Anteil mindestens 25 Prozent des Verkehrswerts betragen muss. Nehmen wir das Beispiel der Eltern Bernasconi, die ihr Wohnobjekt mit einem Verkehrswert von 750 000 Franken an die Kinder übertragen. Letztere übernehmen eine Hypothek von 100 000 Franken und gewähren den Eltern eine Nutzniessung im Wert von rund 160 000 Franken. Von den verbleibenden 490 000 Franken bezahlen die Kinder nur 290 000 Franken; ihnen werden also 200 000 Franken geschenkt. Dieser Betrag entspricht mehr als einem Viertel des Verkehrswerts, sodass die Kinder keine Grundstückgewinnsteuer zu zahlen haben.
Wohnrecht und Nutzniessung: Die wichtigsten Unterschiede
Begründung
Wohnrecht: Grundsatz: öffentliche Beurkundung. Ausnahme: einfache Schriftlichkeit bei Testament bzw. Erbvertrag
Nutzniessung: Grundsatz: öffentliche Beurkundung. Ausnahme: einfache Schriftlichkeit bei Testament bzw. Erbvertrag
Dauer
Wohnrecht: Befristet oder lebenslänglich. Vorzeitige Beendigung durch einseitigen Verzicht des Wohnberechtigten möglich.
Nutzniessung: Befristet oder lebenslänglich. Vorzeitige Beendigung durch einseitigen Verzicht des Nutzniessers möglich.
Rechte
Wohnrecht: Der Wohnberechtigte darf die Immobilie selbst bewohnen. Das Wohnrecht ist unvererblich und unübertragbar, weshalb eine Vermietung nicht erlaubt ist.
Nutzniessung: Der Nutzniesser darf die Immobilie selbst bewohnen oder vermieten. Die Mieteinnahmen stehen dem Nutzniesser zu.
Gewöhnlicher Unterhalt
Wohnrecht: Vom Wohnberechtigten zu tragen
Nutzniessung: Vom Nutzniesser zu tragen
Ausserordentlicher Unterhalt
Wohnrecht: Vom Eigentümer zu tragen
Nutzniessung: Vom Eigentümer zu tragen
Hypothekarzinsen
Wohnrecht: Vom Eigentümer zu tragen
Nutzniessung: Vom Nutzniesser zu tragen
Versicherungsprämien
Wohnrecht: Vom Eigentümer zu tragen
Nutzniessung: Vom Nutzniesser zu tragen
Gebühren
Wohnrecht: Vom Eigentümer zu tragen
Nutzniessung: Vom Nutzniesser zu tragen
Einkommenssteuer
Wohnrecht: Der Eigenmietwert wird durch den Wohnberechtigten versteuert.
Nutzniessung: Der Eigenmietwert wird durch den Nutzniesser versteuert.
Vermögenssteuer
Wohnrecht: Vom Eigentümer zu versteuern, Hypotheken können von ihm in Abzug gebracht werden.
Nutzniessung: Vom Nutzniesser zu versteuern, Hypotheken können von ihm in Abzug gebracht werden.